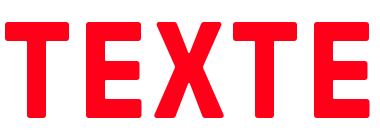Einführungstext von Urs Bugmann anlässlich einer Lesung aus "Tauben fliegen auf",
Rathausbühne Willisau 30. Januar 2011
«… ich bin keine Reisende, sondern eine, die weggeht und nicht weiss, ob sie jemals zurückkommt, und jedes Mal, wenn ich weggefahren bin, habe ich mein Zimmer peinlich genau aufgeräumt …», sagt Ildiko, die Erzählerin in Melinda Nadj Abonjis Roman «Tauben fliegen auf». Das Buch ist aus der Ungewissheit erzählt und in seine Sätze sind Bewegungen eingeschrieben: das Weggehen, das Zurückkehren. Es sind Bewegungen, die den Aufbruch kennen, aber keine Ankunft.
Es beginnt mit einer Rückkehr. Ildiko und ihre Schwester Nomi reisen mit ihren Eltern aus der Schweiz zurück in die Vojvodina, in den Norden Serbiens, wo die Familie Kocsis einst zur ungarisch sprechenden Minderheit zählte. Schon die erste Szene des Romans zeigt, dass, wer zurückkehrt nicht mehr dazu gehört. Die Rückkehrer fahren im schokoladenbraunen Chevrolet ein. Sie haben es zu etwas gebracht und sie haben etwas verloren. Sie sind Fremde, die das Hiersein nur noch in Erinnerungen bewahren, nicht mehr so recht an die Gegenwart knüpfen können. Vor allem die Töchter, aus deren Sicht Ildiko als Ich-Erzählerin spricht, erleben den Bruch im Selbstverständlichen. Sie blieben im Land ihrer Kindheit bei der Grossmutter, als die Eltern weggingen. Ihre Erinnerung an das, was ihnen Heimat bleiben wird, ist noch frisch: «Der weiche Singsang meiner Grossmutter, das nächtliche Gequake der Frösche, die Schweine, wenn sie aus ihren Schweinchenaugen blinzeln, das aufgeregte Gegacker eines Huhnes, bevor es geschlachtet wird, die Nachtviolen und Aprikosenrosen, derbe Flüche, die unerbittliche Sommersonne und dazu der Geruch nach gedünsteten Zwiebeln, mein strenger Onkel Móric, der plötzlich aufsteht und tanzt. Die Atmosphäre meiner Kindheit.»
Das ist der Rückkehrerin Ildiko noch lebhaft in Erinnerung, aber da ist auch ein Schmerz und eine Grenze, die sie erfährt und die sie unruhig macht: «Alles noch da?», fragt sie. Und ist auch alles noch so, wie es war? Diese Frage markiert präzise die Distanz und den Verlust. Die Ungewissheit wird als Dauerschmerz bleiben, wird auch jedes spätere Weggehen und Ankommenwollen einfärben.
Melinda Nadj Abonji, die 1968 in der Vojvodina geboren wurde und inzwischen eingebürgerte Schweizerin ist, erzählt in diesem ihrem zweiten Roman die Geschichte einer Familie, die aus dem zerfallenden Tito-Jugoslawien in die Schweiz auswandert. Erst geht der Vater, später die Mutter, schliesslich kommen die beiden Töchter nach. Für sie fällt das Weggehen zusammen mit dem Erwachsenwerden. In jedem Wortsinn verlassen Ildiko und Nomi das Land der Kindheit.
«Tauben fliegen auf» ist die Geschichte von Melinda Nadj Abonjis Familie und ihrer selbst – und ist es nicht. Aus eigener Erfahrung und eigenem Erleben nährt sich diese individuelle Geschichte, die sich so zwanglos mit der Geschichte Europas in den letzten paar Jahrzehnten verbindet. Doch sie geht über das Eigene hinaus und wird zum Exempel.
Ildiko und Nomi versuchen anzukommen. Sie haben vor Augen, wie ihre Eltern sich ihre Existenz im fremden Land erarbeitet haben, wie sie um Zugehörigkeit und um das Anerkanntwerden kämpfen, wie sie sich einzufügen und anzupassen versuchen und doch fremd bleiben. Es ergeht auch den Töchtern nicht anders, mögen sie sich auch rebellisch auflehnen. Da sind Grenzen, sichtbare und verborgene, deklarierte und unbewusst errichtete, die zur Erfahrung des Verlusts durch das Weggehen den Schmerz des nicht Ankommen Könnens hinzufügen.
Davon spricht Melinda Nadj Abonji nicht in der Proklamation von Zuständen, sondern im Erzählen – im Nachzeichnen von Bewegungen. Sie lässt Ildiko von ihrem Alltag im Café ihrer Eltern, unter Mitstudenten und in der Gegenwelt der besetzten Wohlgroth-Fabrik erzählen. Es sind bildstarke Szenen, und es ist eine Sprache, die das Erleben von innen heraus beleuchtet. Die unaufhebbare Distanz des Fremdseins schärft nicht allein das Auge der Beobachterin. Sie formt mit an der Sprache, die in ihren musikalischen Klängen und Rhythmen, in den leicht hingemalten poetischen Bildern etwas von jener Welt und Atmosphäre bewahrt, die Heimat bleibt, auch wenn sie mit keiner Rückkehr mehr erreicht werden kann.
Dieses Buch bewegt und berührt nicht nur mit seiner Geschichte. Es ist ein Sprachkunstwerk, das auf die Worte dieselbe Aufmerksamkeit richtet, dieselbe Sorgfalt anwendet wie auf die geschickt gefügten Fäden der Geschichte, die einmal komisch und dann wieder traurig ist. Eine weiche und anschmiegsame Sprache voller Zwischentöne trägt das Erzählen. Sie fasst das Glück, sie findet Worte für die Liebe und andere für die Schrecken des Kriegs. Immer ist es eine Sprache, die zwischen Meinen und Sagen keinen Unterschied kennt, die kein falsches Spiel treibt und keine leeren Fassaden aufrichtet. Es ist eine Sprache voller Leben – und voller Zuneigung für die Menschen, von denen sie erzählt.
Dieses Buch der Bewegungen, des Zurück- und Weggehens ohne Ankunft, der Suche nach der Gewissheit eines Orts, eines Ichs, einer Zugehörigkeit, kennt selber kein Ankommen. Es endet mit einem Aufbruch und führt die Bewegung ins Unbestimmte fort. Dorthin würde man der Erzählerin gerne folgen und weiter von ihr lesen. Das Happy-End dieses Buches ist nicht das Erreichen und Einfügen, sondern das Ankommen eines Ichs bei sich selbst – nicht an einem Ort des Bleibens, sondern an einem Ort des Fortgehens. Denn jene Grunderfahrung des Verlassenseins, des Weggehen- und Zurücklassenmüssens, aus der heraus dieses wunderbare Buch geschrieben ist, lässt sich nur in der Bewegung aufheben – und das meint hier das Bewahren und Verwandeln. Das kann nur die Bewegung. Und sei es die Bewegung des Fortschreibens.
Urs Bugmann