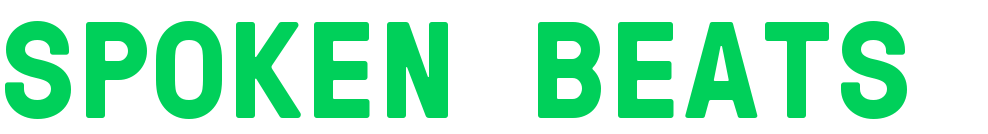Erschienen in entwürfe Nr. 48, Schweizer Zeitschrift für Literatur
DIALEKTIK
Notizen zur Mundart
Meinen ersten schweizerdeutschen Text schrieb ich 1997, als ein Wachmann namens Christoph Meili einen Aktenstappel der UBS vor dem Shredder rettete und ein Stück Schweizer Geschichte plötzlich in Amerika spielte. Robert Studer, seinerzeit Chef der Bank, sprach von Peanuts, die Black Eyed Peas waren Untergrund und Schweizer Rap steckte noch in den Nike Air Forces.
1988,
It takes a nation of millions to hold us back,
das zweite Album von Public Enemy,
Rap auf dem Höhepunkt
und ich knie auf dem Spannteppich
vor dem Plattenspieler
im holzgetäferten Zimmer meines Bruders:
Bring the noise.
Wie kommt man zum Schweizerdeutschen? Wie kommt man dazu, in der Sprache, in der man spricht, zu schreiben? Einfacher ist es zu sagen, ich schreibe in der Sprache, in der ich denke. Natürlich denke ich automatisch in Hochdeutsch, wenn ich diesen Text schreibe. Sobald ich aber vor hiesigem Publikum stehe, möchte ich den Leuten aus dem Mund sprechen. Ich möchte, dass meine Worte die ihren sein könnten, Worte, die ihnen auf der Zunge liegen, die ihnen im Hals stecken bleiben, die sie nicht aussprechen.
Mündliche Literatur?
Ein unbefriedigender Begriff,
erfüllt die Beschreibung von:
zuerst das Schreiben, dann der Vortrag.
Ist kein eigenständiger Begriff.
Das zeigt schon:
da klafft eine Lücke in der Kultur.
1998 trat ich zur Wiedereröffnung der Schule für Dichtung in Wien auf, Ernst Jandl las vor mir einige seiner Dialektgedichte. Bei Ernst Jandl gibt es diesen Moment der Irritation: Der Dialekt ist nicht gleich die gesprochene Sprache, der Dialekt ist zuerst eine Klangwelt, die dem Zuhörer vertraut ist. Und genau bei dieser Vertrautheit setzen seine Texte an. Locken den Zuhörer aus der Reserve, führen ihn auf eine falsche Fährte, verdrehen ihm das Wort im Mund, weil es auch seine Sprache ist, mit der da gesprochen wird.
Dieses Glatteis fasziniert mich bis heute, auch wenn man sich damit kaum über Wasser halten kann. Diesen suggestiven Dialekt, diese Form von verdichtetem Klang kannte ich aus der Schweiz nicht. Mundart? Ich benutze diese Sprache, weil ich hier aufgewachsen bin, hier lebe, hier höre und Worte wie Füdlibürger liebe.
Mein Vater ist ein Hochdeutscher.
Mein Vater ist seit August 1961 ein Tourist in der Schweiz.
Er lässt sich durch die Migros zur Vollmilch führen.
Streckt dem Jungen am Billettautomaten eine Zehnernote hin und sagt: einmal nach Zürich, bitte. Grüezi klingt bei ihm wie Grütze.
In der Wohnung meiner Eltern hängt im Korridor ein Berliner Stich mit einem Spruch von Zille:
Meine Wurst ist jut,
wo keen Fleesch iss, da is Blut,
wo keen Blut iss, da sind Schrippen,
an meine Wurst ist nich' zu tippen!
Wenn du noch lange in den Spiegel schaust,
dann kommt der Grawuzl und holt dich!
Meine Mutter ist in Bayern aufgewachsen.
Hat in zwei Jahren Schweizerdeutsch gelernt. Akzentfrei.
Buebl is, Kotl hassts!
Es isch en Bueb und heisst Käti!
Sinngemäss übersetzt: Das hätten wir erledigt!
Mein Vater ist für die Deutschschweizer ein Ausländer,
für die Hannoveraner hat er eine Berliner Schnauze.
Für die Welschen ist er jeweils der einzige Schweizer, der richtiges Deutsch spricht, für die Berliner ist er weder Fisch noch Vogel.
Tucholskys Gedicht Mutters Hände: Lesen!
Meine Mutter ist ein Lutherfan. Früh hat sie mir von seinen Bibelübersetzungen erzählt. Damit das gewöhnliche Volk sie auch versteht. So, wie den Leuten der Schnabel gewachsen ist, hat er geschrieben.
Mundart? Mit diesem Wort werde ich nicht recht warm.
Freestyle. Blind Date. Ich spreche, also bin ich. Lichtgeschwindigkeit, der Flügelschlag eines Kolibris fächelt mir kühle Luft zu, keine Zeit für Hochdeutsch, sorry.
Das sind jetzt aber geschriebene Gedanken, gedachte Formulierungen, das wahre Schreiben platzt aus einem heraus, ich meine, ich kann meine Ideen nicht steuern. Texte, bei denen ich etwas Gewolltes spüre, mag ich nicht. Ich will diesen freien Fluss. Nun ist es oft nicht ganz einfach, diesem Fluss über eine längere Zeitspanne freien Lauf zu lassen, ohne ihn zu begradigen und trotzdem ans Meer zu kommen.
Das Sprechen, der Rhythmus, der Reim, das Pulsieren der Sprache, die Ungereimtheiten in der Sprache: Deshalb mache ich den Mund auf.
Reim und Rhythmus sind eine Gegenbewegung zur Abstraktion.
Christoph Meili und meine erste CD Drehscheibe Schweiz als Reaktion darauf kamen zehn Jahre nach Public Enemys Timebomb.
Ich bin über eine Fremdsprache zum Dialekt gekommen.
Das wahre Schreiben platzt aus einem heraus.
Und ist dem Sprechen sehr nahe.